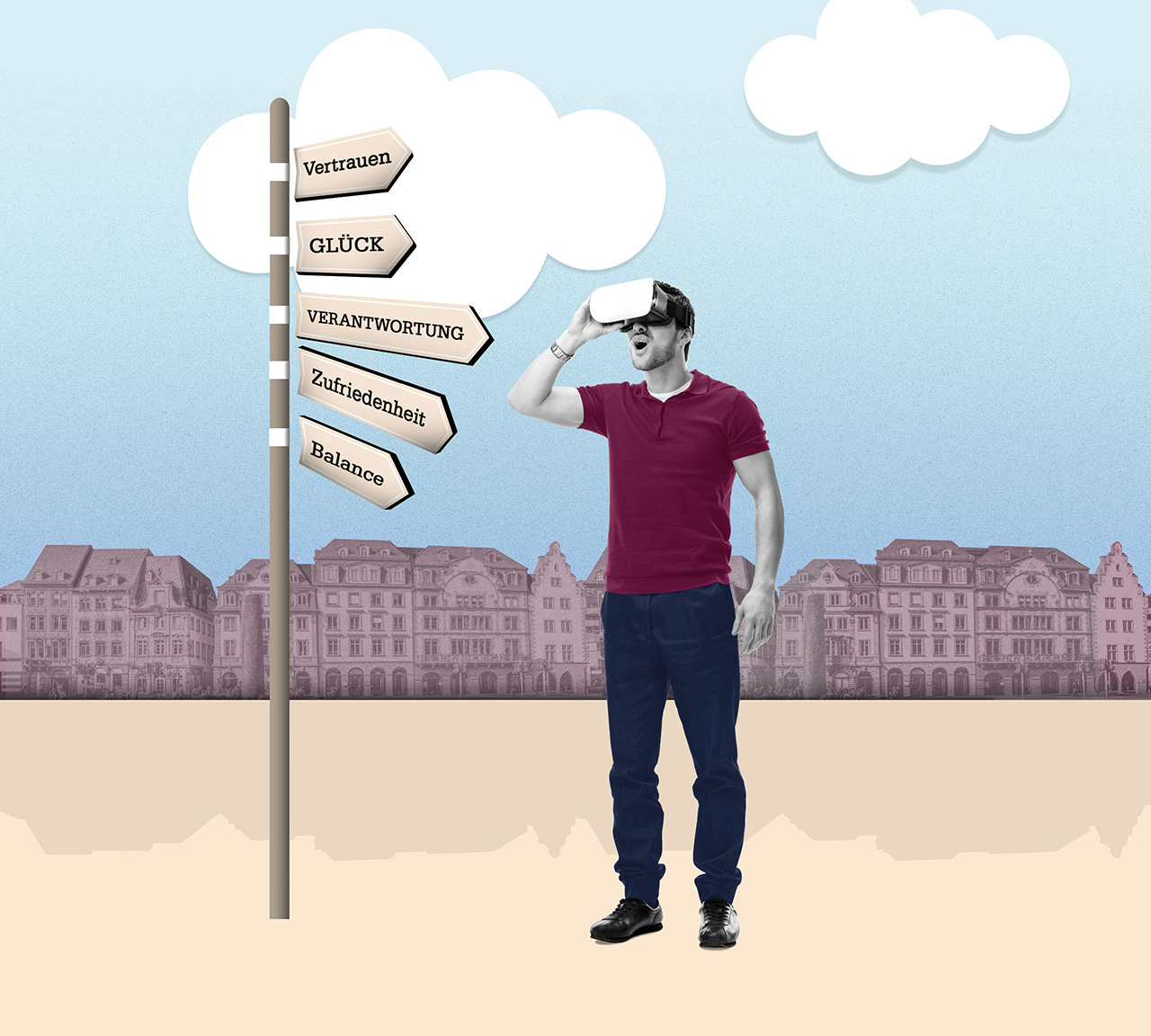I. #utopia, # bigfail
Wie könnte eine radikal bessere Zukunft aussehen? Generationen von Utopisten haben sich an dieser Frage abgearbeitet. Einer von ihnen war August Engelhardt. Im Herbst 1902 schiffte sich der Nürn- berger Apothekerlehrling, Vegetarier und Nudist in das kaiserliche Kolonial-Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea aus. Auf der kleinen Insel Kabakon, einem Sprengsel des Bismarck-Archipels, erwarb Engelhardt eine Kokosnuss-Plantage. Dort gründete er die „Aequatoriale Siedlungsgemeinschaft Sonnenorden“. Die Mitglieder des Sonnenordens wollten frei von Kleidung und Eigentum friedlich zusammenleben. Dabei sollten sie sich nahezu ausschließlich von Kokosnüssen ernähren. Seine Utopie nannte Engelhardt entsprechend „Kokovorismus“. In der musste auch niemand arbeiten. Die Nüsse fielen ja einfach von den Palmen auf den Strand.
So abstrus die Lehre klang: In den kommenden Jahren folgten einige Dutzend Zivilisationsmüde dem Ruf der Kokovoren in die Südsee. Das Leben im Sonnenorden erwies sich dann allerdings als nicht ganz so utopisch. Nicht nur tropischen Viren und Malaria machten den Aussteigern zu schaffen. Die einseitige Ernährung durch Kokosnüsse führte zu Mangelerscheinungen. Zudem erwies der Ordensgründer sich zunehmend so gar nicht als gütiger Guru ursozialistischer Prägung, sondern wurde immer eigensinniger und herrschsüchtiger. Sogar ein Mord soll sich auf Kabakon ereignet haben. Nach einigen Jahren Krankheit und Streit war von der kleinen Ordensgemeinschaft dann nur noch Engelhardt übriggeblieben. Aus der Utopie wurde eine Lachnummer. Touristen fuhren nach Kabakon, um den Spinner August Engelhardt zu sehen und zuhause davon erzählen zu können. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts stand es also nicht unbedingt gut um den Ruf der Utopie. August Engelhardt mag mit seiner kleinen Kolonie besonders grandios gescheitert sein. Aber im Kern steht sein Schicksal für das vieler Utopisten vor und nach ihm. Sie erdachten und versprachen viel. Ihre Pläne blieben oft wolkig und abstrakt. Kaum einem Utopisten gelang es, einen ausreichend großen Teil der Vorstellung einer wünschenswerten Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Mit jedem Scheitern verlor das utopische Denken an Ruf. Im Zuge des 20. Jahrhunderts wurde „Utopie“ wahlweise zum Synonym für „Luftschloss“ oder „Spinnerei“.
II. Die konstruktive Kraft der konkreten Utopie
Der Abstieg der Utopie zur Lachnummer ist mehr als schade. Er ist ein Fehler. Denn natürlich können wir nur auf eine bessere Zukunft hinarbeiten, wenn wir eine Vorstellung davon entwickeln, wie eine Gesellschaft in Zukunft dem Einzelnen, den Familien und der Gemeinschaft ein besseres Leben, eine bessere Arbeitswelt und bessere soziale Beziehungen ermöglicht.
Der deutsche Philosoph Ernst Bloch hat die Ambivalenz der Utopie früh erkannt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mochte er die Frage nach der radikal besseren Zukunft nicht aussortieren, da ja ohnehin jede Utopie zum Scheitern verurteilt sei. Bloch forderte, die Frage im Wortsinn zu konkretisieren. Er forderte die konkrete Utopie. Damit meinte er: Wir müssen beschreiben können, was in einer besseren Zukunft denn genau für wen und wie besser wäre. Je konkreter und plausibler wir eine Utopie erdenken und beschreiben, so Bloch, desto stärker kann sie eine konstruktive Kraft entfalten. Das ergibt Sinn, und zwar auch nach den Erkenntnissen der Sozialpsychologie des 21. Jahrhunderts. Pessimismus ist im günstigen Fall Zeitverschwendung, weil er nur schlechte Laune macht. Im Normalfall jedoch raubt er jede Energie, etwas nach vorne zu bewegen, getreu dem Motto: Klappt ja eh nicht. Ein rational optimistisches Weltbild kann hingegen eine Dynamik in umgekehrter Logik in Gang setzen. Denn Wünsche und Sehnsüchte spielen eine entscheidende Rolle dabei, ob wir uns als Einzelne und Gemeinschaften ambitionierte Ziele setzen und diese dann auch erreichen können.
III. Arbeit, die man wirklich, wirklich will
Allein ist Bloch mit dieser Vorstellung nicht. Frithjof Bergmann hat sich selbst nie als Utopist bezeichnet, auch wenn viel Anhänger des großen Vordenkers der „neuen Arbeit“ (New Work) einen Utopisten in ihm sahen. Vielleicht hat Bergmanns romanhafte Biogafie dazu beigetragen. Seine Mutter war Jüdin. Die Familie floh vor den Nazis aus Sachsen zunächst nach Österreich. Nach dem Anschluss musste die Mutter einen Selbstmord vortäuschen.
Der Vater war im Krieg. Frithjof und seine Geschwister schlugen sich durch. 1946 wanderte der hochbegabte Schüler mithilfe eines Stipendiums in die USA aus. Neben dem Philosophie-Studium verdingte er sich als Tellerwäscher, Fließbandarbeiter und Preisboxer. Er lehrte als junger Hochschullehrer in Stanford, Berkeley und der University of Chicago. Er zog sich zwei Jahre in eine abgelegene Waldhütte zurück, um einmal wirklich ungestört nachdenken zu können. Ende der Fünfzigerjahre fand er seine akade-mische Heimat an der University of Michigan, im Kernland der US-amerikanischen Automobilindustrie.
Noch stärker als sein Philosophenkollege Ernst Bloch hatte Frithjof Bergmann einen Hang zur Praxis. Er beriet Regierungen und Kommunen, Unternehmen und Gewerkschaften, Jugendliche und Arbeitslose, wie sie eine bessere Zukunft rund um Arbeit und Wertschöpfung für sich und andere gestalten können. Von linken Utopien hatte Bergmann sich spätestens nach Reisen in den Ostblock in den Siebzigerjahren verabschiedet. Die Antworten für eine neue Arbeitswelt in einem humanen Kapitalismus erarbeitete er lieber mit Fließbandarbeitern und Managern von General Motors in seinem „Center for New Work“.
In den Achtzigerjahren erdachte und erprobte Frithjof Bergmann dort, was heute auf HR-Kon- ferenzen gefeiert und in deutschen Konzernen unter der Überschrift „New Work“ inszeniert wird. Und im Unterschied zu vielen Akteuren der heu- tigen New-Work-Bewegung konnte Bergmann sein Ziel für eine neue Arbeitswelt in so präzise wie verständliche Worte fassen. Seine Philoso- phie in einem Satz verdichtet lautet: „Arbeit, die man wirklich, wirklich will“. Um das zu erreichen, legte er einen konkreten Plan vor, wie man diese Utopie denn erreichen könne. Fünf Stationen müssen Unternehmen und Mitarbeiter gemeinsam passieren:
1. Freiheit schaffen
Wer frei arbeitet, hat keine Angst vor Chefs oder Kollegen. Das hört sich selbstverständlich an, ist es aber nicht. Zur Freiheit gehört für Bergmann auch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren und Fehler zu machen. Ein Unternehmen mit neuer Arbeitskultur schafft Experimentierräume.
2. Selbstverantwortung leben
Können sich Mitarbeiter in hohem Maße selbst organisieren? Dürfen sie Budgetentscheidungen im sinnvollen Maße selbst treffen? Werden sie am Erfolg des Unternehmens angemessen beteiligt? Diese Fragen stellte Bergmann Managern mit großer Hartnäckigkeit, ohne dabei vollständige Hierarchiefreiheit zu fordern. Viele Mitarbeiter wollen zumindest flache Hierarchien.
3. Sinn geben
Sinn ergibt Arbeit für Bergmann, wenn sie mehr ist als Gewinnmaximierung für (anonyme) Kapitaleigner. Sie muss Mehrwert für Mitarbeiter und Kunden, lokale Gemeinschaften und Unternehmer schaffen.
4. Entwicklung ermöglichen
(Nahezu) jeder Mitarbeiter möchte sich entwickeln. Entwickeln heißt im Sinne Bergmanns zunächst einmal Dazulernen. Die wichtigste Quelle des Lernens sind die Kollegen, die Wissen weitergeben oder als Sparringspartner bei der Selbstreflexion unterstützen, wie Dinge künftig besser gehen könnten. Das ist freilich keine Einbahnstraße von Lehrmeister zu Lehrling, sondern ein wechselseitiger Prozess, an dem viele, im Idealfall alle im Unternehmen teilnehmen und teilhaben.
5. Soziale Verantwortung tragen
Die fünfte Station auf dem Weg zur neuen Arbeit ist eng mit der dritten verknüpft. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit, regionales Engagement und Unternehmertum nach den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns sind für Bergmann Grundpfeiler, auf denen „New Work“ fußt. Diese Pfeiler geben Arbeit einen Sinn jenseits persönlicher Freiheit, Selbstverantwortung und Entwicklung. Frithjof Bergmanns Kalkül lautete: Wenn der einzelne Mitarbeiter und ein Unternehmen als Ganzes in allen fünf Dimensionen von New Work konsequent voranschreiten, nähern wir uns einer radikal besseren Arbeitswelt. Dann arbeiten die meisten Menschen in diesem Unternehmen so, wie sie es wirklich, wirklich wollen. Doch ist das wirklich umzusetzen?
IV. Utopien für Realisten
Kritiker würden sagen: Die Utopie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie dazu verdammt ist, ein hübsches, aber in letzter Konsequenz nutzloses Gedankenspiel zu bleiben. Sie sei unter den gegebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar. Das kann man so sehen. Aber das ist nutzlos. Produktiver ist die Haltung des jungen niederländischen Autoren Rudger Bregman. In bester Tradition Ernst Blochs und Frithjof Bergmanns glaubt er an eine Utopie, die ungewöhnlich erscheint und der doch eine große Zukunft hat: die Utopie für Realisten.
Besonders in der Arbeitswelt hält er solche Utopien für möglich und setzt dabei auf den sogenannten „Pygmalion-Effekt“. Diesen hat in den 1960er-Jahren der US-Psychologe Robert Rosenthal entdeckt und beschrieben. Er besagt: Wenn Lehrer oder Führungskräfte ihren Schülern oder Mitarbeitern besonders viel zutrauen und ihnen mehr Verantwortung übertragen als erwartet, steigt nicht nur die Leistung erheblich, sondern auch die Zufriedenheit mit Schule und Arbeit. Sie wird so zu Arbeit, die wir wirklich wirklich wollen.
Aus einer Utopie, die nie zu erreichen scheint, wird somit eine Utopie, die längst in greifbarer Nähe ist – für jeden Einzelnen. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Unternehmen für die Umsetzung geeignet sind, dann wird klar: Unternehmen, die Mitarbeitern in kleineren Einheiten bei flachen Hierarchien viel Freiheit und Gestaltungsraum geben und doch als Verbund zusammenhalten. Das ist keine Theorie, sondern Praxis. Ein Vorreiter war der Folien- und Spezialstoffhersteller Gore. Unternehmenseinheiten und einzelne Fabriken haben dort nie mehr als 150 Mitarbeiter und organisieren sich weitgehend selbst. Der Schweizerische Pharmariese Novartis geht zurzeit einen ähnlichen Weg der Aufteilung in kleinere Zellen unter dem überraschend provokanten Motto „Unboss the company“. Das international expandierende niederländische Pflegeunternehmen Buurtzorg setzt sehr erfolgreich auf radikales Wachstum in kleinen, autonomen Zellen von zehn bis fünfzehn Pflegekräften. Im Handel gibt die große Drogerie-Kette DM den kleinen Teams in jeder Filiale ungewöhnlich hohe Freiheiten, sich selbst zu organisieren. Gleiches gilt für die Teams und Stores des kultigen schweizer Taschen-Labels Freitag. In der kleinen Einheit mit großem Freiraum liegt eine große Chance – auch und gerade für den Handel.
Zwar wird der Diskurs zu New Work in Deutschland dominiert von den HR-Abteilungen von Großunternehmen und Beratern, die diese in New-Work-Projekten beschäftigen. Eine Konferenz jagt die nächste, auf der sich die New-Work-Community selbst feiert und diese Feier dann auf LinkedIn oder Xing bildreich teilt.
Doch wer in die Unternehmen reinhorcht und nachfragt, wieviel mehr an Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung von den Events in den Unternehmensalltag der Großorganisationen hineinwirkt, und ob das Gerede über New Work zu Arbeit führt, die man wirklich, wirklich will, dann lautet die Antwort oft: eigentlich gar nicht. Gelebt wird New Work hingegen schon lange an Orten, an denen der Begriff nicht diskutiert wird. Die Wertschöpfung dort ist oft Dienstleistung, also wo Menschen anderen Menschen einen Dienst erweisen. An diesen Orten spürt man oft schon beim ersten Betreten ein hohes Maß an Kollegialität, das soziale Bindung und persönliche Weiterentwicklung ermöglicht. An diesen Orten wird niemand übervorteilt, denn es gelten die Regeln des ehrbaren Kaufmanns.
Ein gutes Geschäft ist eines, das für alle Beteiligten gut ist. Mit allen Beteiligten sind gemeint: Händler und Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter, Nachbarschaften und die Innenstädte, in denen gute Geschäfte für Leben und Bindung sorgen.
Jeder gute Händler weiß, wovon die Rede ist. Denn sein Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der diesem Idealbild möglichst nahekommt. Der Einzelhandel ist also vielleicht genau das, was viele große Unternehmen gern wären: eine sehr konkrete Utopie.
Text: Thomas Ramge
Illustration: Chrissie Salz